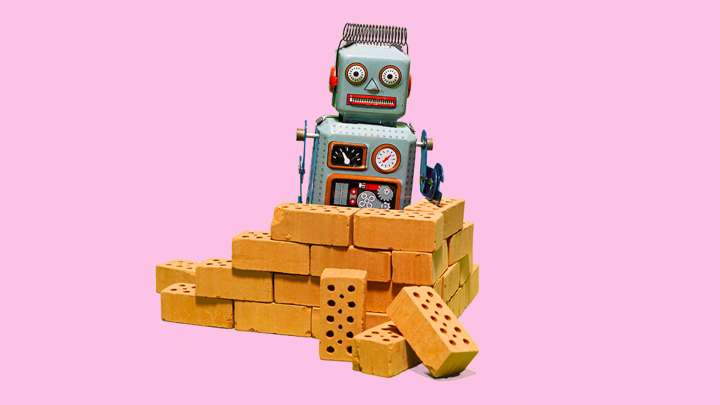Der Lebenslauf, eine Liste auf Steroiden
Warum haben Eheprobleme nichts mehr im Lebenslauf zu suchen? Die Soziologen Julian Hamann und Wolfgang Kaltenbrunner haben untersucht, wie sich akademische Bewerbungsschreiben seit 1950 verändert haben

fluter: Sie haben untersucht, wie sich akademische „Lebensläufe“ in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Wie sah denn ein Lebenslauf in den 50er-Jahren aus?
Wolfgang Kaltenbrunner: Das war eine ausformulierte, durchgehend geschriebene Lebenserzählung. Die fing üblicherweise mit der Geburt an: „Ich, Wolfgang Kaltenbrunner, bin am 9. September 1933 geboren.“ Dann folgten die Konfession und der Beruf der Eltern. Die soziale Herkunft spielte eine große Rolle. Auffällig ist, dass nicht zwischen öffentlich und privat unterschieden wurde. Wir haben zum Beispiel einen Text gefunden, in dem der Bewerber über seine Eheprobleme schreibt und warum die ihn an seiner Karriere gehindert hätten.
Und das sollte Eindruck beim Bewerbungskomitee machen?
Kaltenbrunner: Das Ziel war es eben, eine konsistente Geschichte zu erzählen. Zu der gehörten auch Brüche, der persönliche Weg aus einer Krise.
Julian Hamann: Diese Erzählform entwickelte einen Zwang zur Kohärenz: Alles musste in die Erzählung passen. Es genügte nicht, wie heute, die professionelle Persona zu zeigen, die Bewerber*innen mussten sich komplett preisgeben – bis ins Allerprivateste.

Hamann und Kaltenbrunner haben 80 Bewerbungsschreiben für Professuren in den Fächern Germanistik und Geschichtswissenschaft untersucht. Und dabei drei markante Veränderungen ausgemacht: Lebensläufe sind heute (1.) um ein Vielfaches länger, haben sich (2.) von einer durchgehenden Erzählung zur Liste entwickelt und (3.) ihre Erzählrichtung geändert: Heute beginnen sie mit den jüngsten Projekten, nicht mehr mit Geburt und Jugend
Wie hat sich diese Privatheit in den Folgejahrzehnten aus dem Lebenslauf verabschiedet?
Hamann: Wir konnten insgesamt vier Formate unterscheiden, die der Lebenslauf seit den 50er-Jahren angenommen hat. Dem eben beschriebenen narrativen Format folgte das segmentierte Format, also mehrere kleine Erzählungen in thematischen Kapiteln. Dann kam die Listenform, und erst seit etwa 2010 beobachten wir eine Form, die wir die „überdifferenzierte Listenform“ nennen.
Zeigt diese Lebensliste von heute, dass der Druck in der Arbeitswelt gestiegen ist?
Kaltenbrunner: Unter anderem. In der Wissenschaft konkurrieren heute viel mehr Menschen um anteilig weniger Stellen und Mittel. Der Wettbewerb ist größer geworden und mit ihm der Bedarf an Komplexitätsreduktion. In Listenform lassen sich Lebensläufe leichter und systematischer vergleichen, oder zumindest scheinen sie vergleichbarer.
Hamann: Daneben ist der Druck gestiegen, die eigene Performance sichtbar zu machen. Die Selbstdarstellung von Wissenschaftler*innen hat sich professionalisiert und definiert sich heute stärker über Leistung. Aber die Listenform wirkt auch auf die Wissenschaftler*innen zurück: Sie versuchen nicht mehr nur, ihr Leben in Stichpunkten zu beschreiben, sondern müssen diese Listen auch erst mal lang werden lassen und buchstäblich mit Leben füllen.
Kaltenbrunner: Wissenschaftler*innen haben die ständige Bewertung ihres Tuns heute verinnerlicht. Man könnte fast sagen, sie haben ihren CV (Curriculum Vitae, die im Englischen übliche Bezeichnung für den Lebenslauf, Anm. d. Red.) nicht mehr, um Wissenschaft zu betreiben, sondern betreiben Wissenschaft, um einen CV zu haben.
Sie haben unter anderem festgestellt, dass sich im Laufe der Jahrzehnte die Erzählrichtung gedreht hat. Statt mit der Geburt beginnen Lebensläufe heute mit der jüngsten Publikation und verlaufen dann antichronologisch. Hat die Herkunft der Bewerber*innen an Bedeutung verloren?
Hamann: Spätestens mit den 60er-Jahren wollte man in der Wissenschaft die Errungenschaften von den biografischen Wurzeln abkoppeln, sie als Leistungen für sich stellen. Das gilt aber nur für den Lebenslauf. Empirisch ist die soziale Herkunft nach wie vor wichtig für eine wissenschaftliche Karriere. Die Information, woher jemand kommt, ist eben nur in informellere Bereiche verschoben worden, etwa ins Vorstellungsgespräch. Da bekommt die eigene Klasse dann durch Sprache oder Auftreten immer noch ihren Raum.
Dann wird heute informeller diskriminiert.
Hamann: Früher waren andere Argumente aktenfähig. Da konnte man jemandem offiziell Manieren, ein repräsentatives Auftreten oder „Historikerblut“ attestieren. Heute wird so was immer noch gesagt, aber eher in der Kaffeepause. Die offiziellen Argumente müssen sich auf die Leistung beziehen.
„Was früher nebenbei gemacht wurde, zum Beispiel die Betreuung von Doktorand*innen, ist heute eine Leistungskategorie“
Sie haben eine dritte Tendenz ausgemacht: Die Lebensläufe sind über die Jahrzehnte deutlich länger geworden.
Hamann: Bei unserer Untersuchung ist der Durchschnittslebenslauf von Germanist*innen von anderthalb auf 17 Seiten angewachsen. Das liegt auch daran, dass immer mehr Aspekte der wissenschaftlichen Tätigkeit als Leistung sichtbar gemacht werden.
Und hat zur „überdifferenzierten Listenform“ geführt, die Sie heute beobachten?
Hamann: Genau. Was früher nebenbei gemacht wurde, etwa die Betreuung von Doktorand*innen, ist heute eine Leistungskategorie. Dazu kommen neue Aspekte, zum Beispiel der Outreach, also dass man Aufmerksamkeit für seine Arbeit erzielt. Dieses Interview hier werde ich mir natürlich später auch in den CV schreiben.

Die Studie wurde im Journal „Research Evaluation“ veröffentlicht
Wenn sich die Biografien weiter in dem Tempo aufblähen, sind wir in 20 Jahren bei 100 Seiten Lebenslauf. Zieht da jemand eine Grenze?
Hamann: Einige Forschungsförderungen beschränken die Zahl der Publikationen, die man angeben darf, bereits auf zehn. Da lohnt es sich weniger, wie blöd auf Masse zu publizieren.
Kaltenbrunner: Daneben gibt es europaweit Experimente, in denen versucht wird, zu narrativen Formaten zurückzukehren. Der Evaluationswahnsinn mit zu viel Wettbewerbsdruck und Wissenschaftler*innen, die Publikationen spammen, wird schon länger kritisch gesehen und diskutiert. Die Idee ist: weniger wissenschaftliche Leistungsdaten, kürzere Listen, mehr substanzielle Geschichten.
Ihre Studie hat sich mit akademischen Lebensläufen befasst. Lassen sich die Ergebnisse trotzdem auf nichtakademische Gruppen anwenden?
Julian Hamann: Ohne das untersucht zu haben, würde ich vermuten, dass sich unsere Ergebnisse im Wesentlichen übertragen lassen. Es gibt schließlich allgemeine Entwicklungen, die auch für nichtakademische Arbeitsmärkte gelten. Zum Beispiel die Ausdifferenzierung der Leistungskategorien und der Evaluationsformate, die diese Leistungen bewerten. Oder die sogenannte Dynamisierung der Arbeitsverhältnisse, durch die Arbeitnehmer*innen in ihrem Erwerbsleben häufiger in Bewertungs- und Bewerbungssituationen kommen.
Wolfgang Kaltenbrunner: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich die von uns beschriebenen Entwicklungen auf jedem Arbeitsmarkt beobachten lassen, der – wie der akademische – durch ein Missverhältnis zwischen der Anzahl der Bewerber*innen und der verfügbaren Stellen gekennzeichnet ist.
Wie lang sind Ihre Lebensläufe?
Kaltenbrunner: Meiner ist sehr kurz. Ich bin zu faul, ihn aktuell halten. Meistens vergesse ich irgendwas.
Hamann: Ich pflege meinen Lebenslauf kontinuierlich. Wenn ich mich bewerbe, kürze ich. Aber für mich ist das ein Verzeichnis dessen, was ich gemacht habe. Deswegen sind es bei mir 20 Seiten.
Würden Sie sagen, dass Sie Ihre Lebensläufe aufgeblasen haben?
Kaltenbrunner: Nein.
Hamann: Die Frage ist für mich nicht so einfach … In meinem Lebenslauf steht schon viel. Aber nicht weil ich es toll finde, mich darzustellen, sondern weil ich weiß, dass es die Anforderung eines Systems ist, in dem ich gern bleiben will. Ich sag’s mal so: Don’t hate the player, hate the game!

Wolfgang Kaltenbrunner ist Senior Researcher am Centre for Science & Technology Studies der Universität Leiden. Er arbeitet zu wissenschaftlicher Kommunikation und Peer Review.

Julian Hamann, Juniorprofessor für Hochschulforschung an der Humboldt-Universität Berlin, forscht vor allem zu Bewertungen und Fachkulturen im Rahmen akademischer Karrieren.
Illustration: Renke Brandt / Portraits: privat
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.