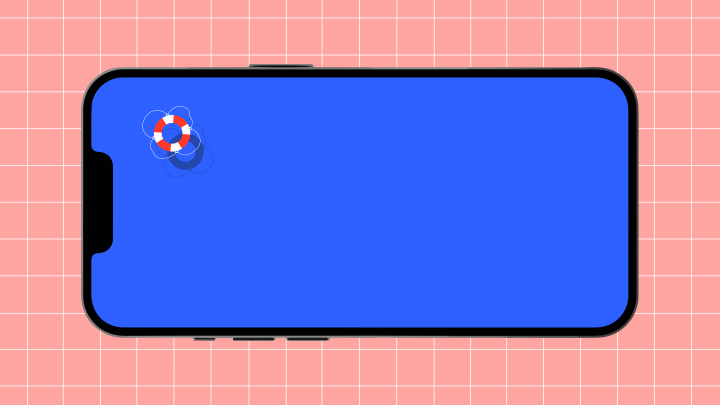Ein Universum der Fehlinformationen
Viele Lehramtsstudierende gehen nicht zur Psychotherapie – denn sie fürchten, später nicht verbeamtet zu werden. Ist die Angst begründet?

Ella ist Lehrerin. Verbeamtete Lehrerin. Für diesen Zusatz hat sie einiges durchgemacht. Und weil ihre Verbeamtung im Raum stand, hat sie sich, als es ihr schlecht ging, nicht gleich Hilfe gesucht. Damit ist Ella (Name geändert) nicht allein. Wer im Netz nach „Verbeamtung trotz Psychotherapie“ sucht, findet Foren voll von Berichten Betroffener. Sie alle ringen mit der Frage, ob sie sich therapeutische Hilfe suchen können, ohne die Verbeamtung zu riskieren.
Schon im Studium dachte Ella über eine Psychotherapie nach, später dann im Schulalltag. Dort war die psychische Belastung von Beginn an groß. „Im Referendariat gab es in dem kleinen Kollegium drei Personen, die wegen Burn-out und psychischen Erkrankungen mehrere Monate weg waren.“
„Alle Eltern haben meine private Handynummer. Als Lehrerin ist man auch sehr als Privatperson involviert“
Zu Stress bei der Arbeit gesellten sich Zukunftssorgen. „Ich war mir nach dem Referendariat nicht sicher, ob ich überhaupt Lehrerin sein will. Ich finde, das starre System, in dem man festhängt, passt einfach nicht mehr in die Zeit. Das ist immer noch ein Faktor, der mich sehr stresst.“ Ella begann als Vertretungslehrerin. Sie wollte sich Freiheit erhalten und plante, ein Jahr im Ausland zu unterrichten.
Doch dann brachen die Pläne zusammen. Sie erlebte das erste Mal Panikattacken. „Privat war die Beziehung mit meinem Partner gerade gescheitert, den Auslandsaufenthalt habe ich abgesagt, es war alles zu viel.“ Mit der Pandemie verschmolzen Arbeit und Freizeit. „Alle Eltern haben meine private Handynummer“, sagt Ella. Viele schicken auch am Wochenende lange Sprachnachrichten. „Als Lehrerin ist man auch sehr als Privatperson involviert“, sagt sie.
Trotzdem wartete Ella mit der Therapiesuche und bewarb sich erst auf eine feste Stelle. „Der Leidensdruck war groß“, erinnert sie sich. „Ich habe es immer hinbekommen, meine Arbeit mehr oder weniger vernünftig zu machen. Aber im Alltag konnte ich meine Wohnung nicht aufräumen oder mir was zu essen machen.“ Erst nach einigen Monaten, als Beamtin auf Probe, begann sie, eine*n Therapeut*in zu suchen, und recherchierte zu möglichen Konsequenzen. Sie landete in Internetforen und fand wenig zuverlässige Quellen. „Wenn man versucht, was darüber herauszufinden, ist es echt schwer. Das ist einfach ein Riesenmythos. Und auch wirklich alle, mit denen man spricht, haben nur so ein gefährliches Halbwissen.“
Seit einem Gerichtsurteil 2013 ist die Ablehnung einer Verbeamtung sehr unwahrscheinlich geworden
Matthias Albers ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie beim Gesundheitsamt Köln. Er hat rund 15 Jahre lang Beamt*innen bei der Einstellung und auf Dienstunfähigkeit untersucht. Internetforen wie die, in denen Ella recherchiert hat, kennt auch er. „Das ist ein unendliches Universum der Fehlinformationen.“ Viele Ängste seien unbegründet.
„Der Stellenwert der Begutachtung hat sich durch die seit zehn Jahren bestehende Rechtsprechung drastisch reduziert“, sagt Albers. 2013 urteilte das Bundesverwaltungsgericht, dass eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit […] einer Dienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze“ bestehen muss, um eine Verbeamtung abzulehnen. Das Urteil habe die Lage geändert. Albers beschreibt die Einschätzung von psychisch vorerkrankten Bewerber*innen seitdem so: „Die Gutachter müssen schauen: Gibt es irgendwelche Studien zu dieser Erkrankung, in denen drinsteht, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Erwerbsunfähigkeit eintritt?“ Diese Frage lasse sich fast immer mit Nein beantworten. „Da wird man einfach in der Regel nicht fündig. Es gibt praktisch keine psychische Erkrankung, inklusive Schizophrenie und bipolare Störung, wo das Risiko für einen schwerwiegenden chronischen Verlauf, der zur Erwerbsunfähigkeit führt, höher ist als 10 bis 15 Prozent.“
Betroffenen rät Albers: „Wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Behandlung oder Therapie, geh hin und mach das. Entweder die Therapie hilft dir richtig gut und du wirst schnell genesen. Dann kriegst du eine Bescheinigung, dass du genesen bist, und gut ist. Oder es läuft schlechter: Die Therapie ist nur mittelprächtig, und du hast schwer zu kämpfen mit einer psychischen Erkrankung. Dann hast du gute Chancen, einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen. Das heißt, du wirst gleichgestellt und musst sowieso eingestellt werden.“
Wichtig sei jedoch, seine eigene Situation realistisch einzuschätzen. „Wer eine ernsthafte psychische Erkrankung hat und wem klar ist, dass neben Behandlung auch immer wieder Rehabilitation nötig wird, um arbeiten zu können, der sollte wirklich nicht Beamter werden“, so Albers. Denn als Beamt*in zahle man nicht in die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung ein, die die Rehabilitation finanzieren. „Dann hat man keinen Anspruch auf die Leistungen.“
Kompliziert wird die Sache dann aber bei der Suche nach der passenden Krankenkasse
Ist die Verbeamtung geschafft, kann die Wahl der Versicherung zu einer Hürde werden. Laut Verbraucherzentralen und Stiftung Warentest ist es für Beamt*innen in der Regel günstiger sich privat zu versichern. Doch Daniela Hubloher von der Verbraucherzentrale Hessen rät dabei zur Umsicht.
„Der Einstieg in eine private Krankenversicherung kann eine Entscheidung fürs Leben sein“, so Hubloher. Eine Rückkehr in die gesetzliche Versicherung ist mit sehr hohen Hürden verbunden, daher ist es sehr wichtig, die verschiedenen Tarife zu vergleichen. „Es ist nicht wie bei der gesetzlichen Versicherung, da sind 95 Prozent der Leistungen im Sozialgesetzbuch festgelegt.“ Bei den Privaten besteht nur Anspruch auf das, was im Vertrag steht. „Die Tarife sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bei Psychotherapien gibt es ganz abgespeckte Einsteigertarife, die gar keine enthalten, andere haben eine Begrenzung auf 20 bis 30 Stunden pro Jahr oder decken nur einen Teil der Kosten.“
Die Öffnungsaktion
Wer die Öffnungsaktion der privaten Krankenversicherer nutzen möchte, sollte auf einiges achten. „Die Möglichkeit besteht nur in den ersten sechs Monaten nach Begründung des Beamtenverhältnisses und nur bei dem ersten Anbieter, bei dem ein formeller Aufnahmeantrag gestellt wird“, sagt Daniela Hubloher von der Verbraucherzentrale Hessen.
Deshalb sei bei der Recherche besondere Vorsicht geboten. „Wenn man verschiedene unverbindliche Angebote einholt, sagt man erst bei dem Unternehmen, zu dem man dann auch wirklich hinwill, dass man diese Öffnungsaktion wahrnimmt“, betont Hubloher. Die erleichterten Zugangsbedingungen für Beamt*innen erstrecken sich „über alle Formen von Erkrankungen oder laufenden Behandlungen, also auch psychische bzw. psychotherapeutische“, schreibt der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. auf Nachfrage.
Für Vorerkrankte kann es schwierig sein, überhaupt in eine private Versicherung zu kommen. „Wer eine Erkrankung hat oder ein gesundheitliches Risiko mitbringt, kann abgewiesen werden“, sagt Hubloher. Sie rät unbedingt zu ehrlichen Antworten bei der Risikoabfrage. „Die Versicherungen prüfen die Angaben oft erst, wenn Jahre später Leistungen anfallen.“ Schon eine nicht angegebene Physiotherapie könne dazu führen, dass die Versicherung nicht zahle oder vom Vertrag zurücktrete. Am sichersten sei es, sich einen Ausdruck der eigenen Krankenakte zu besorgen.
Eine Option für Beamte, die gerade ins Berufsleben starten, kann die sogenannte „Öffnungsaktion“ sein: 16 private Krankenversicherer haben sich selbst dazu verpflichtet, in den ersten sechs Monaten nach der erstmaligen Verbeamtung niemanden wegen Vorerkrankungen abzulehnen. Dabei sollen keine Leistungen ausgeschlossen werden, allerdings fallen teilweise Risikozuschläge an. Diese Zuschläge sind zwar auf 30 Prozent begrenzt, trotzdem kann dadurch der Beitrag deutlich erhöht sein. Die Versicherung möchte durch die höheren Beiträge einkalkulieren, dass dieser Kunde ziemlich teuer werden könnte, wenn weitere Behandlungen notwendig werden.
Ella hat erst nach ihrer Verbeamtung eine Therapie angefangen. Die Psychologin diagnostizierte eine Angststörung. Rückblickend glaubt Ella, schon während des Referendariats hätte ihr eine Therapie geholfen. Auch um zu lernen, mit stressigen Situationen besser umzugehen.
Hier sieht auch Facharzt Matthias Albers Handlungsbedarf. „Das Problem ist nicht, nicht verbeamtet zu werden. Sondern wenn man dann verbeamtet worden ist, wie man es schaffen will, diesen Beruf bis zur Rente durchzuhalten, ohne krank zu werden.“ Lehrer*in sei ein „Hochrisikoberuf“ für psychische Erkrankungen, der besondere Maßnahmen erfordere. „Eigentlich müsste man Menschen, die sich für das Lehramtsstudium einschreiben, erst mal intensiv beraten und später im Beruf eine maximale arbeitsmedizinische Beratung bieten.“
Illustration: Renke Brandt
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.