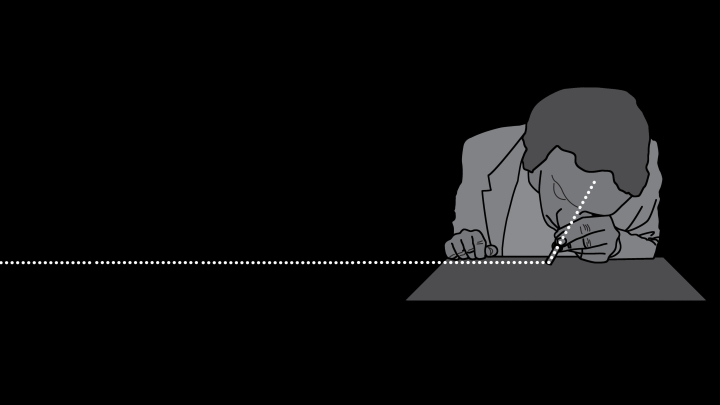Vergiftete Hoffnung
Ein Friedensabkommen gab Kokabauern in Kolumbien die Aussicht auf ein Leben außerhalb der Illegalität. Doch fünf Jahre später lässt die Regierung statt Geld vielleicht bald wieder Glyphosat auf die Bauern regnen

Aus knorrigen Stümpfen sprießt frisches, helles Grün. Vor knapp neun Monaten habe ein Militärtrupp die Pflanzen abgehackt. Das erzählt Camilo Ospina*, ihm gehört die Kokaplantage in den Tiefen des Regenwaldes in Putumayo, einem Verwaltungsgebiet im Südwesten des Landes. Gut ein Drittel der Pflanzen auf dem einen Hektar großen Areal wurden zerstört. Langsam wachsen neue Blätter nach.
Ospina baut seit mehr als 20 Jahren illegal Kokapflanzen an. Er lebt in ständiger Angst – vor dem Militär, vor den Drogenhändlern, davor, dass auch seine vier Kinder keine Zukunft haben außerhalb der Illegalität. Mit traditionellem Ackeranbau kann Ospina seine Familie nicht unterhalten. Zu weit sind die Transportwege, zu gering die Bezahlung. Mit nur drei Jahren Schulbildung hätte Ospina auch in der Stadt keine Chance. Wegziehen ist also keine Option. Als sich 2016 der Friedensvertrag mit der FARC anbahnte, hatte er die Hoffnung, endlich aussteigen zu können. Denn unter Punkt vier war vorgesehen, den Kokaanbau als Motor des bewaffneten Konfliktes nachhaltig zu bekämpfen und Kokabauern die Möglichkeit zu verschaffen, ihren Lebensunterhalt legal zu verdienen.
Fünf Jahre sind seit der Unterschrift des Friedensvertrages vergangen. Er ist eines der ausgefeiltesten Friedensabkommen der modernen Geschichte, brachte dem damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis ein und Kolumbien internationalen Applaus. Ein jahrzehntelanger bewaffneter Konflikt zwischen Regierung und Guerilla sollten damit zu Ende gehen. Fünf Jahre, das ist ein Drittel der vorgesehenen 15 Jahre, die für die Umsetzung der Vertragsziele vorgesehen sind. Die Regierung unter Präsident Iván Duque singt heute ein Loblied auf die Erfolge der freiwilligen Kokasubstitution – und plant gleichzeitig, erneut Glyphosat mit Flugzeugen aus der Luft zu sprühen. Eine Taktik, die 2017 vom kolumbianischen Verfassungsgericht wegen gesundheitlicher Bedenken mit einer Reihe von Auflagen belegt und damit de facto ausgesetzt wurde. Die Regierung sät damit weiteres Misstrauen unter den Kokabauern, von denen viele ohnehin kaum noch Vertrauen in den Staat haben.

Ospina etwa glaubt nicht mehr daran, dass sich für ihn noch etwas ändert. Er hatte sich für das Substitutionsprogramm der Regierung angemeldet und alle seine Kokapflanzen aus dem Boden gerissen. Aber von den versprochenen Hilfen sei nur ein kleiner Teil angekommen. Bloß zwei Monate lang habe er jeweils eine Million Pesos erhalten – insgesamt rund 500 Euro. Eine Summe die knapp über dem Mindestlohn liegt. Statt der versprochenen rund 2700 Euro finanzielle Unterstützung im ersten Jahr sowie Saatgut für Lebensmittel im Wert von rund 4000 Euro. „Die Regierung hat uns betrogen“, sagt Ospina. Und er sei drauf reingefallen.
Die offiziellen Zahlen der Regierung spiegeln Ospinas Schicksal indes nicht wider. Laut Jahresbericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC, der auf Zahlen der Regierung beruht, haben Kokabauern in Kolumbien seit dem Friedensvertrag rund 40.000 Hektar Kokapflanzen freiwillig vernichtet. Und weniger als ein Prozent der Bauern soll demnach zum Kokaanbau zurückgekehrt sein. „Wir tun alles Nötige, um die im Vertrag vereinbarten Ziele einzuhalten“, sagt Emilio Archila, Regierungberater für die Stabilisierung und Konsolidierung des Friedens.
Im Vergleich zu Koka bringen Kochbananen und Yucca kaum Geld – und lassen sich auch noch schwerer transportieren
In Villagarzón bekommt man davon nicht viel zu spüren. Die Gemeinde ist etwa drei Autostunden von der ecuadorianischen Grenze entfernt und die Stadt, die am nächsten an Ospinas Kokafeld dran ist. In einem Saal des Gemeindehauses sitzt Jorge Hernán Gaviria* auf einem Plastikstuhl. Gaviria hat früher selbst Koka angebaut. Heute setzt er sich für die Kokabauern in der Region ein: „Von den 400 Familien, die hier Koka anbauen, ist derzeit keine Teil eines Substitutionsprogrammes“, sagt er. Es habe zwar Versuche gegeben, aber die hätten nicht gefruchtet: „Teilweise kamen die versprochenen Finanzhilfen nicht an, teilweise war das Saatgut schlecht“, erzählt er. Die größten Probleme aber seien nach wie vor der Transport und die Verarbeitung der Ernte. „Kochbananen, Yucca, Chontaduros – all diese Lebensmittel wiegen viel. Es gibt aber keine gepflasterten Straßen, sodass die Bauern die Ernte per Pferd oder auf dem Rücken transportieren müssen.“ Das koste Zeit und bringe wenig Geld. Für 14 Kilo Chontaduro etwa, die kleine orange Frucht der Pfirsichpalme, gebe es hier 30.000 Pesos, rund sieben Euro. Ein Kilo Kokapaste bringe hingegen zwei Millionen Pesos, etwa 500 Euro.

Und die Gemeinde in Putumayo ist kein Einzelfall. Mehrere internationale Medien berichten inzwischen über den Konflikt mit den Kokabauern. Für Williams Jimenez-Garcia ist das keine Überraschung. Er forscht seit Jahren zum Drogenhandel in Kolumbien: „Die Informationen über den Erfolg der staatlichen Maßnahmen kommen vom Staat selbst. Was wirklich in diesen Zonen passiert, spiegelt sich in den Statistiken wohl kaum wider.“ Vielleicht lässt sich so auch erklären, dass die Statistiken über den Kokaanbau in Kolumbien sich teils widersprechen. So geben Zahlen des kolumbianischen Staates an, dass sich die Anbaufläche im Jahr 2020 um sieben Prozent reduziert habe, von 154.000 Hektar im Jahr 2019 auf 143.000 Hektar. Das Büro für nationale Drogenkontrollpolitik des Weißen Hauses (ONDCP) spricht hingegen von einem Anstieg der Anbauflächen um beinahe 15 Prozent für das Jahr 2020. In einer Pressemitteilung vom Juni 2021 gab die Duque-Regierung bekannt, dass beide statistischen Teams die Zahlen nun überprüfen würden, um die Messungen in Zukunft zu „harmonisieren“.
Bleibt außerdem die Frage, warum die Regierung künftig wieder das potenziell gesundheitsgefährdende Totalherbizid Glyphosat aus der Luft einsetzen will, wenn doch die Substitutionsprogramme große Erfolge zeigten. Diego Molano, Kolumbiens Verteidigungsminister und einer der lautesten Befürworter des Glyphosateinsatzes aus der Luft, ließ eine Interviewanfrage innerhalb einer Frist von zwei Wochen unbeantwortet.
Wächst da eine weitere Generation von Kokabauern heran?
Kokabauer Ospina steht unter einer Plastikplane im Wald, nahe an seiner Plantage. Neben ihm ein Fass mit Kokaresten. Im Hintergrund: Benzinkanister, Batteriesäure, Kalk. Die Zutaten für die Produktion der Kokapaste, der Vorstufe des Kokains. Vor einigen Tagen hat er in diesem provisorischen Labor die letzte Fuhre Kokapaste produziert. Für Ospina sind die neusten Glyphosat-Pläne nur eine weitere Bestätigung, dass der Staat nicht wirklich daran interessiert sei, den Kokabauern zu helfen. „Sie nennen uns Narco-Terroristen, sie greifen uns an, sie lügen. Hilfe hingegen gibt’s keine.“

Dass Hilfen noch nicht in alle Gegenden Kolumbiens vorgedrungen seien, sei dem Zeitplan entsprechend normal, sagt Emilio Archila. „Der Friedensprozess ist auf 15 Jahre ausgelegt, nicht auf fünf. Das kann man langsam finden, aber wer seriös analysiert, für den ist das schnell.“
Forscher Williams Jimenez-Garcia hingegen glaubt nicht daran, dass mehr Zeit die Lösung des Problems ist. „Das Vertrauen der Leute schwindet. In weiteren fünf Jahren werden wir mit anderen Dingen beschäftigt sein und bald haben wir eine weitere Generation an den Drogenanbau verloren. Und damit an die Gewalt, denn der Drogenhandel ist der Motor für den bewaffneten Konflikt im Land.“
Für Ospina jedenfalls ist es zu spät. Selbst wenn ein neues Substitutionsangebot aufgelegt würde, er würde nicht mehr mitmachen. „Lieber lebe ich in Angst, als mich noch einmal von dieser Regierung reinlegen zu lassen“, sagt er. Seine Entscheidung steht. Nur, wenn bei den Wahlen in diesem Jahr eine komplett andere Regierung an die Macht käme, würde er es sich vielleicht nochmal überlegen.
*Die Namen wurden geändert, um die Personen zu schützen. Sie sind der Redaktion bekannt.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.