Die ganz große Nähe
Paris, Berlin oder Hamburg wollen eine „15-Minuten-Stadt“ sein. Sieht so die Metropole der Zukunft aus?
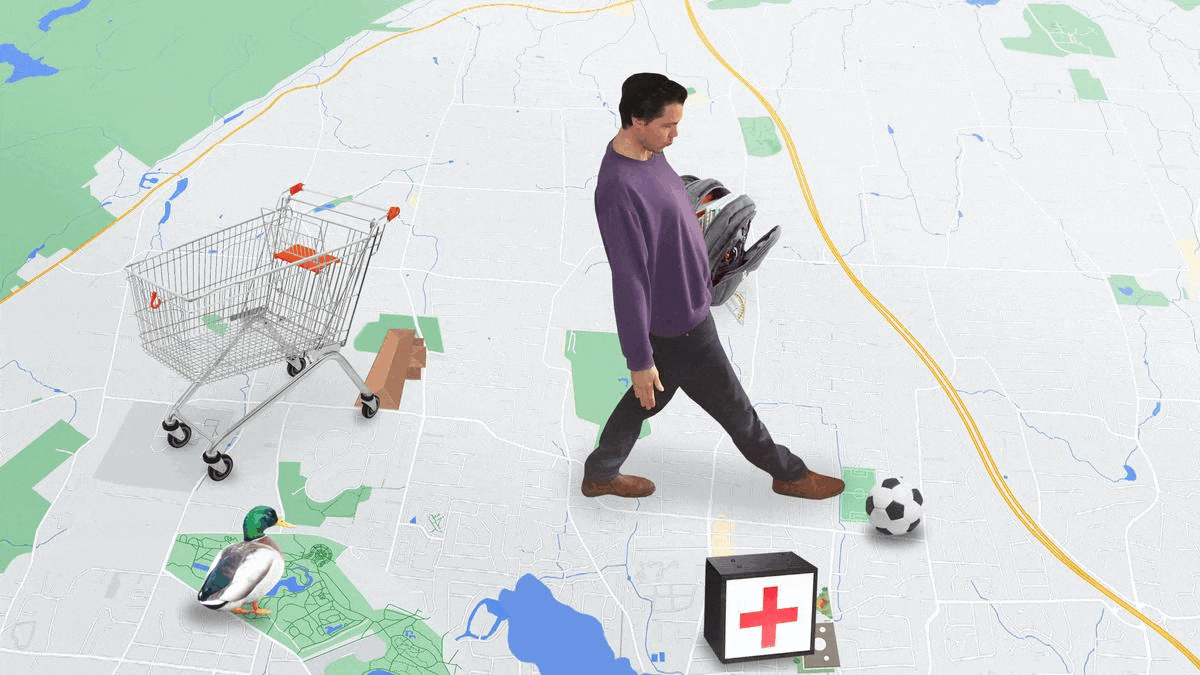
In einer Viertelstunde alles erreichen, was man für das tägliche Leben braucht: Lebensmittelhandel, Schulen, Kitas, Ärzt*innen, Parks und Sportplätze. Ohne Auto, dafür mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das ist die simple Idee hinter der 15-Minuten-Stadt. Und gerade weil dieses anschauliche Leitbild im Kontrast steht zu vielen anderen akademischen Stadtkonzepten, ist die „15-Minuten-Stadt“ schwer in Mode.
Dabei ist die Idee nicht neu. Bereits seit den 1980er-Jahren kursieren Konzepte wie die „Stadt der kurzen Wege“ oder „Compact Cities“. Sie gelten als Gegenbewegungen zu dem Leitbild, das zuvor dominierte: die funktionelle Stadt, entwickelt 1933 und festgeschrieben vom Architekten Le Corbusier in der „Charta von Athen“. Ihr Ziel war eine Funktionstrennung: Arbeiten und Wohnen sollten an unterschiedlichen Orten stattfinden und durch gut ausgebaute Straßen miteinander verbunden sein. Die Effekte sehen wir bis heute. Große Autobahnen, die die Städte durchziehen, riesige Parkplätze im öffentlichen Raum, alltägliche Rushhours, die vom Speckgürteln in die Innenstadt und zurückstauen.
Was heißt Radweg auf Französisch? Die Pariser*innen haben jetzt jedenfalls viel davon
Veränderungen in der Stadtplanung brauchen lange, bis sie wirken. Bereits 2007 schrieb die EU in der „Leipzig-Charta“ die Neuausrichtung der Stadtentwicklung fest. Grün, gerecht und produktiv soll sie sein, so steht es in ihrer Weiterentwicklung, der „Neuen Leipzig-Charta“ von 2020. Heute bringt die „15-Minuten-Stadt“ diese Ausrichtung auf den Punkt: Wenn die einzelnen Quartiere die Bedürfnisse des Alltags abdecken können, dann haben die Bewohner*innen mehr Zeit, die Stadtplaner*innen mehr Platz abseits der Straßen, und es gibt weniger Lärm, Emissionen und Abgase in der Stadt. Welche Bedeutung der Umbau zu funktionierenden Quartieren haben kann, zeigte sich während der Pandemie. Wer krank war, kranke Menschen versorgte oder in der Quarantäne festsaß, war für eine gut ausgebaute Nahversorgung dankbar.
Paris zählt zu den Pionieren der 15-Minuten-Stadt. Zwischen 2010 und 2018 ist die Zahl der täglichen Fahrten in dem Ballungsgebiet Île-de-France mit dem Fahrrad um 30 Prozent gestiegen, was auch der Bürgermeisterin Anne Hidalgo zugeschrieben wird. Während der Pandemie wurden 50 Kilometer Radwege ausgebaut, bis zu den Olympischen Spielen 2024 soll jede Straße in der französischen Hauptstadt auch eine Radspur haben. Außerdem sollen 60.000 Straßenparkplätze aus dem öffentlichen Raum verschwinden und stattdessen Grün- und Freiflächen entstehen, auf denen die Bürger*innen explizit zum Gärtnern eingeladen sind. Schon seit 2016 sind in einigen Pariser Quartieren die Straßen an Sonn- und Feiertagen für den motorisierten Verkehr gesperrt. In vier Bezirken ist der erste Sonntag im Monat autofrei, an einem Tag im Jahr sogar die ganze Stadt.
Dieser Fokus auf lebenswerte Quartiere und nichtmotorisierten Verkehr wurde auch in anderen Städten aufgegriffen, etwa im australischen Melbourne, im kolumbianischen Bogotá, in Mailand, Kopenhagen, Utrecht und Wien.
Und wie sieht es in Deutschland aus? „Die ‚15-Minuten-Stadt‘ ist in den dicht bebauten Innenstädten bereits vielerorts Realität“, sagt Uta Bauer, Mobilitätsforscherin am Deutschen Institut für Urbanistik. „In kleineren Städten wie Jena, Landau oder Weimar ist das ganz offensichtlich, aber auch in Großstädten wie Berlin oder Hamburg sind die Alltagsziele zu Fuß, mit dem Rad oder ÖPNV selten weiter als 15 Minuten entfernt.“
Aber nicht überall. Die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg, sagt: „In den Außenbereichen der Städte ist die ‚15-Minuten-Stadt‘ leider bis heute noch nicht umgesetzt.“ Und auch da, wo die Erreichbarkeit schon gegeben sei, könne man noch viel tun, um die Lebensqualität zu erhöhen und die Verkehrswende voranzubringen. Der Plan sei, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, Sharing-Angebote auszuweiten und Fuß- und Radwege sicherer zu gestalten. Außerdem sollen mithilfe von Wirtschaftsförderungen Anreize für die Einrichtung von Kitas, Arztpraxen, Sportangeboten oder den Einzelhandel geschaffen werden, so Berg. „Am Ende ist die ‚15-Minuten-Stadt‘ ein Angebot. Und das Gelingen hängt wesentlich davon ab, dass die Menschen dieses Angebot auch wahrnehmen.“ Dem stimmt auch die Mobilitätsforscherin Uta Bauer zu: „Wer immer nur online bestellt, kann keinen Tante-Emma-Laden im Quartier erwarten“, sagt sie.
Im Internet kursieren derweil Verschwörungserzählungen zu den „15-Minuten-Städten“. Menschen sollten damit in ihren Stadtvierteln eingesperrt werden, heißt es, begründet auf Bestrebungen der Stadt Oxford, weniger Autoverkehr zuzulassen. Dafür sollen ab 2024 Kameras eingesetzt werden, die erkennen, welche Autos auf der Straße fahren dürfen und welche nicht. Diese Idee hängt aber gar nicht direkt mit der „15-Minuten-Stadt“ zusammen und betrifft andere Städte nicht.
Ist die 15-Minuten-Stadt zu schön, um wahr zu sein?
Eine echte Kehrseite des Konzepts gibt es aber: Wo der Verkehr beruhigt und die Nahversorgung gut ist, da steigen oft die Mieten. Das könne man in Immobilienanzeigen nachvollziehen, sagt Bauer, ein lebenswertes Viertel werde von Vermietern vielerorts als Preiskatalysator genutzt. Ist die „15-Minuten-Stadt“ also nur ein weiterer Hebel für Gentrifizierung? „Das kann man nicht ausschließen“, sagt Uta Bauer. „Aber es ist ja auch keine Option, die Stadt laut und dreckig zu lassen.“ Gegen Gentrifizierung würden nur entschlossene wohnungspolitische Maßnahmen wie sozialer Wohnungsbau helfen. Und gegen die „15-Minuten-Stadt“ als Preistreiber nur eine flächendeckende Umsetzung. „Es sollte nicht nur dort investiert werden, wo die Anwohner am lautesten danach rufen“, sagt Bauer.
Doch selbst in den teuren urbanen Vierteln sind die Widerstände gegen verkehrsberuhigte Zonen enorm groß. Das zeigt etwa der zähe Streit um die Sperrung eines Teilstücks der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Und das hat auch Stefanie von Berg bei der Umsetzung des Projekts „Ottensen macht Platz“ erlebt: Der urbane, wohlhabende Stadtteil im Westen von Hamburg war zwischen September 2019 und Ende Januar 2020 weitgehend autofrei. Darüber und über die langfristige Sperrung zweier zentraler Verkehrsachsen für den Autoverkehr gibt es bis heute Streit in den sozialen Medien. „Die absolute Mehrheit der Anwohner will diesen Umbau. Aber für einige ist es schwer, jahrzehntealte Gewissheiten wie ‚Ich darf mein Auto überallhin fahren und kostenlos parken‘ aufzugeben,“ sagt von Berg. „Da muss man richtig dicke Bretter bohren.“ Es kann also noch Jahre dauern, bis der Verkehr in Ottensen tatsächlich entschleunigt wird.
Solche lokalen Beispiele zeigen deutlich, wie viel schneller eine „15-Minuten-Stadt“ ausgerufen als umgesetzt sei, sagt Mobilitätsforscherin Uta Bauer. Verwaltungsdogmen wie etwa die Straßenverkehrsordnung, die den fließenden Verkehr grundsätzlich begünstige, machten es schwer, autogerechte Stadtstrukturen aufzubrechen – zumal in einem Land mit einflussreicher Autolobby. „In den Städten wird sich nur dann etwas verändern, wenn die Menschen das konsequent einfordern und sich selbst als aktiven Teil der Stadt und ihres Viertels begreifen“, sagt Bauer. Die „15-Minuten-Stadt“ entsteht Straße für Straße.
GIF: Renke Brandt
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.



