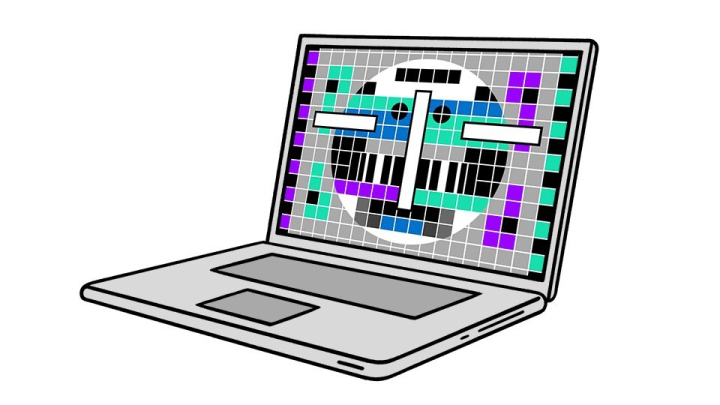Sollten Managergehälter begrenzt werden?
Was für den einen eine überfällige Maßnahme für mehr soziale Gerechtigkeit ist, lenkt für den anderen nur von den wahren Problemen ab. Hier streiten beide

Ja, denn es geht um soziale Gerechtigkeit – und noch viel mehr
So würden astronomische Gehälter von Führungskräften die Wenigverdiener zum Beispiel nachweislich demotivieren, argumentiert Bernd Kramer. Und es gebe sogar Studien, die zeigten, dass sehr hoch bezahlte Manager schlechtere Arbeit abliefern.
Manch einer wird mich jetzt für ein giftiges Wesen halten, das wütend auf den Boden stampft und dem die Galle aus den Augen schießt. Wer sich an hohen Einkommen stört, sieht sich sofort mit dem Vorwurf konfrontiert, man sei doch nur ein Neider.
Als wären die Gründe gegen astronomische Gehälter allein dadurch entkräftet, weil sie einer angeblich falschen Emotion entsprängen. Erstens können auch Gefühle, die man bäh findet, zu den richtigen Schlüssen verleiten. Und zweitens: Stimmt das mit dem Neid überhaupt? Ich würde eher von einem Sinn für Gerechtigkeit sprechen.
Neid? Eher ein Sinn für soziale Gerechtigkeit
Aber lassen wir die Bauchgefühle mal beiseite und fragen nüchtern: Sind gigantische Managergehälter wirtschaftlich sinnvoll?
Nein. Ökonomen argumentieren zwar gern, Gehaltsunterschiede müssten sein, weil sie uns zur Leistung anregten. Das mag stimmen, allerdings mit Einschränkungen: Eine Ingenieurin bei VW mag der Kollegin nacheifern, die befördert wurde. Aber es wird einen Mitarbeiter kaum zu besonderem Einsatz antreiben, wenn das Einkommen der Chefs immer uneinholbar bleibt. Um im Arbeitsleben auf die zwölf Millionen zu kommen, die eine VW-Vorstandsfrau kürzlich nach einem Jahr als Abfindung erhielt, müsste selbst der engagierteste Angestellte mehrere hundert Jahre lang arbeiten. Was ist das für ein Leistungsanreiz?
Große Ungleichheit spornt nicht an, sondern bewirkt das Gegenteil
Zu große Ungleichheit spornt nicht an, sondern bewirkt das Gegenteil. Es demotiviert Mitarbeiter, wenn sie sehen, wie üppig in den Vorstandszimmern das Geld sprudelt und wie klein dagegen die Sprünge sind, die sie mit ihrer Arbeit machen können. Darauf deutet zum Beispiel eine Studie des Ökonomen Nils Braakmann hin, der Daten aus deutschen Firmen ausgewertet hat. Forscherinnen aus London stellten fest, dass Angestellte öfter krank sind, häufiger streiken oder den Arbeitsplatz wechseln, je weiter in ihrer Firma die Spanne zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Gehalt ausfällt. Zu große Ungleichheit ist offenbar schlecht fürs Betriebsklima.
Es ist auch nicht so, als würde ein galaktisches Gehalt die Manager zu galaktischen Leistungen beflügeln. Manchmal passiert sogar das Gegenteil. US-Forscher haben Hinweise dafür gefunden, dass Chefs in ihren Entscheidungen leichtsinniger werden, wenn sie zu hoch bezahlt werden. Wo das Vorstandsgehalt besonders viel Geld verschlingt, entwickeln sich der Studie zufolge Aktienkurs und Gewinn tendenziell schlechter als in anderen Firmen. Wird das Chef-Ego mit zu viel Geld gefüttert, fährt es den Laden im schlimmsten Fall an die Wand. Realistischere Gehälter, kann man aus solchen Ergebnissen folgern, lassen Manager auch realistischere Entscheidungen treffen. Ganz abgesehen davon, dass die Summen an anderer Stelle oft besser eingesetzt sind, etwa um Mitarbeiter einzustellen und neue Produkte zu entwickeln.
Wir haben einen Mindestlohn. Warum nicht auch eine Grenze nach oben?
Wir haben einen Mindestlohn, der die Verdienste nach unten begrenzt. Warum sollte man nicht auch über Grenzen nach oben nachdenken? Man könnte Unternehmen vorschreiben, dass das Verhältnis vom höchsten zum mittleren Gehalt einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. Oder sie zumindest dazu zwingen, sich selbst ein Limit zu setzen, wie es in jüngster Zeit diskutiert wurde.
Am einfachsten wäre es aber, wenn man die Steuern für Spitzeneinkommen deutlich anheben würde. Das hätte zwei Vorteile: Es käme dabei Geld herum, das der Staat in Schulen oder bessere Sozialleistungen investieren könnte. Vor allem aber träfe es auch jene Topverdiener, die keine Unternehmen leiten. Die Gagen im Fußball sind ja auch nicht ohne.
Nein, denn das würde den Blick auf das wahre Problem verstellen
Dieses wäre nicht die Realwirtschaft, sondern der Finanzmarkt, sagt Peter Unfried. Er glaubt: Globale Verteilungsgerechtigkeit erreichen wir erst, wenn wir damit aufhören, immer nur auf die Spitzenverdiener zu schauen. Lohnender sei der Blick nach unten – auf die Menschen weltweit, die viel weniger haben als wir.
Die Verteilung des Wohlstandes ist ein zentrales Thema der Gegenwart. Weil die Gesellschaft nicht über Rationalität, sondern über Stimmungen funktioniert, ist manchmal auch Symbolpolitik wichtig – damit die gesellschaftliche Stimmung nicht kippt und in kompletter Irrationalität zum Aufstieg autoritärer Bewegungen führt.
Doch selbst wenn es für die Begrenzung von Managergehältern gute Gründe geben mag, halte ich den Gedanken für unproduktiv – weil er ernsthafte Zukunftsentwürfe nicht voranbringt, sondern blockiert.
Das große Problem ist nicht die Realwirtschaft, sondern der Finanzmarkt
Erstens: Mit der Fixierung auf die, die in den Wohlstandsgesellschaften noch mehr kriegen als die anderen, wird der Blick nach unten vermieden, zu der ungleich größeren globalen Verteilungsungerechtigkeit – den Milliarden Menschen in Asien und Afrika, die auch etwas abhaben wollen.
Zweitens: Das große Problem ist der globale Finanzmarkt und nicht die Realwirtschaft. Der Trader und nicht der Manager. Derjenige, der nichts herstellt, was andere brauchen, der kein Risiko hat, wenn am Ende der Steuerzahler herhalten muss, um die angeschossene Bank zu retten. Der Spekulationshandel ist nicht nur ungerecht, sondern auch eine riesige Gefahr für das Gemeinwesen. Managergehälter, die um ein Hundertfaches über dem Durchschnittsfirmenlohn liegen, seltsame Boni, riesige Renten sind auch nicht gut. Aber sie sind nicht annähernd so gemeingefährlich wie riskante Börsengeschäfte.
Mit ein bisschen besserer Umverteilung ist es nicht getan
Drittens: Die Forderung, Gehälter nach oben hin zu begrenzen, basiert auf der Annahme, dass wir nur ein bisschen besser umverteilen müssen, damit der Laden wieder läuft – und auch auf ewig weiterrennt. Das ist die Hoffnung der Gesellschaft.
Doch sie ist kompletter Quatsch. Die schöne deutsche Nachkriegsstory von den „hart arbeitenden Menschen“, die mit ihrer schwieligen Hände Arbeit das Land wieder aufgebaut haben – diese schöne Geschichte hat noch nie gestimmt. Weil sie etwas Wesentliches außer Acht lässt: den mutigen Unternehmer.
Der Umbau der bäuerlichen zu einer Industriegesellschaft in den ländlichen Räumen beruht auf den jeweils zwei oder drei pfiffigen Dorfjungs, die in den 1950ern eine Fabrik aufgemacht haben. Dahin gingen dann die ganzen Bauern, weil sie dort mehr verdienten. Ohne den pfiffigen Ausbeuter wären sie mit ihren drei Kühen dagesessen. Selbst wenn er und seine Topmanager das Hundertfache verdienten, war es für alle ein guter Deal.
Gerechtigkeit kann nicht mehr national gedacht werden und schon gar nicht über eine Begrenzung nach oben
Aber im Angesicht fortschreitender Digitalisierung, Automatisierung und künstlicher Intelligenz geht dieses Zeitalter der großen Zechen und Autofabriken, der lokal produzierenden Patriarchen, der Lkw- und Taxifahrer zu Ende. Und das diverser Sparten gehobener Büroarbeit auch. Viele dieser Berufe werden schlicht nicht mehr gebraucht. Ein Studium in der Tasche zu haben, fünf Tage die Woche zu arbeiten, von neun bis fünf präsent zu sein – das ist heute keine Garantie mehr für ein gerechtes Einkommen. Und auch nicht für Qualität.
Der Sozialstaat von gestern ist nicht mit der irrealen Vorstellung einer nationalen Wirtschaft wieder flottzukriegen. Man muss den Sozialstaat für morgen, für das 21. Jahrhundert denken. Das funktioniert nur, wenn man nicht mehr in der Lohn-Logik des Oben-zu-viel und Unten-zu-wenig denkt. Nicht mehr vom Arbeitnehmer, sondern vom Menschen aus. Vergesst also die Managergehälter. Es braucht eine neue Begrenzung nach unten, und die darf nicht im alten Arbeitsethos gedacht werden, also im Mindestlohn. Wir brauchen keine Gehaltsbegrenzung, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.
Collagen: Renke Brandt