Bücher mit Migrationshintergrund
Viele Länder sind Einwanderungsländer. Mal mehr, mal weniger, Deutschland gerade wieder etwas mehr. Für die Literatur sind die kulturellen Verschiebungen ein kostbarer Urstoff. Fünf migrantische Romane, die Literaturgeschichte geschrieben haben.

Chimamanda Ngozi Adichie: „Americanah“
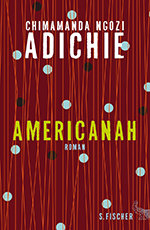
Feminismus, Postkolonialismus und der Lifestyle des modernen Afrika bilden den Rahmen für diesen intelligenten Unterhaltungsroman: Ifemelu, eine schöne, junge und stets gut frisierte junge Frau aus Nigeria, landet eher zufällig mit einem Stipendium in den USA. Dort hat sie es zunächst nicht leicht. Niemand gibt der afrikanischen Studentin einen Job; bittere Armut und eine heftige Depression sind die Folge. Aber Chimamanda Ngozi Adichie, die in außerliterarischen Kreisen dadurch bekannt wurde, dass Beyoncé einen ihrer feministischen Texte in einem Song sampelte, gibt dem Leben ihrer Protagonistin eine nahezu aschenbrödelhafte 180-Grad-Wendung. Nach und nach findet Ifemelu Arbeit, Freundinnen und Liebhaber und macht in Zeiten des ersten Obama-Wahlkampfs als gesellschaftskritische Bloggerin Furore. Doch es hilft alles nichts – ihre Sehnsucht nach Nigeria nimmt mit den Jahren immer mehr zu. Auf dem Höhepunkt ihres US-amerikanischen Erfolgs beschließt Ifemelu dann, nach Afrika zurückzukehren.
Chimamanda Ngozi Adichie: „Americanah“. Fischer, Frankfurt/Main 2014, 608 Seiten, 9,90 Euro
Alina Bronsky: „Scherbenpark“
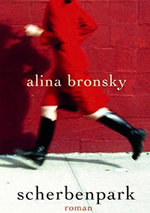
Von so etwas wie „Lifestyle“ würde die durchsetzungsstarke Heldin von Alina Bronskys Debütroman „Scherbenpark“ nicht einmal träumen: Sascha ist 17 und wohnt in einer üblen Hochhaussiedlung am Rand einer faden deutschen Kleinstadt. Seit ihre Mutter von ihrem Stiefvater erschlagen wurde, lebt sie allein mit ihrem kleinen Bruder und einer Haushälterin. Sie sind Russlanddeutsche, wie fast alle anderen, die Sascha kennt, und erst wenige Jahre zuvor eingewandert. Sascha fühlt sich nirgendwo wirklich zugehörig. Sie hasst ihr Leben fast so sehr wie ihren Stiefvater, den sie eines Tages hofft, ermorden zu können. Bevor es dazu kommt, lernt sie jedoch den Journalisten Volker und dessen Sohn kennen und findet in den beiden fast so etwas wie eine neue Familie. Eine wunderbare Wahlverwandtschaft nimmt ihren Anfang. Alina Bronsky hat mit Sascha wunderbar eindrucksvoll gezeigt, dass sich kein Mensch mit dem Leben zufriedengeben muss, das er scheinbar zugeteilt bekommen hat.
Alina Bronsky: „Scherbenpark“. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, 286 Seiten, 16,95 Euro
Jonas Hassen Khemiri: „Das Kamel ohne Höcker“

In Schweden ist er einer der literarischen Shootingstars des letzten Jahrzehnts: der halbtunesische Halbschwede Jonas Hassen Khemiri. Er schreibt nicht nur Bücher, sondern auch Theaterstücke und ist unter anderem in Deutschland ein viel gespielter Bühnenautor. „Das Kamel ohne Höcker“, sein erster Roman, ist das (autobiografisch inspirierte) Tagebuchbekenntnis des 15-jährigen Stockholmers Halim, der mit seiner marokkanischen Herkunft hadert. Einerseits wäre er vielleicht lieber ein „echter“ Schwede, andererseits verachtet er vorsorglich die schwedische Mehrheitsgesellschaft. In aller Heimlichkeit schwärmt er für ein schwedisches Mädchen in seiner Klasse und für den Schauspieler Mikael Persbrandt. Eigentlich ist Halims Tagebuch gar kein Tagebuch, sondern ein dickes Heft, das ihm dazu dienen sollte, Arabisch schreiben zu üben. Stattdessen verschriftlicht er darin sein Rinkeby-Schwedisch – eine migrantisch inspirierte Sprachvariante, die in den Stockholmer Vorstädten gesprochen wird. Kurz: Halim ist so etwas wie ein fleischgewordener kultureller Zwiespalt. Doch kraft seiner überlegenen Selbstironie zieht er sich aus diesem am eigenen Schopf heraus.
Jonas Hassen Khemiri: „Das Kamel ohne Höcker“. Piper, München 2006, 272 Seiten, 15,50 Euro
Feridun Zaimoğlu: „Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft“

Was den Schweden das Rinkeby-Schwedisch, ist den Deutschen die „Kanak Sprak“. Feridun Zaimoğlu erfand den Begriff 1995 für sein gleichnamiges Buch, mit dem er auf einen Schlag zum gehätschelten Enfant terrible der Literaturszene avancierte. Später wurde „Kanak Sprak“ sogar zum wissenschaftlichen Terminus, mit dem manche Linguisten eine Sprachvariante bezeichnen, in der sich ein umgangssprachlich abgeschliffenes Deutsch mit türkischen und arabischen Lehnwörtern mischt. Zaimoğlus „Kanak Sprak“ als linguistisches Abbild der Wirklichkeit zu betrachten wäre allerdings ein Missverständnis. Das Buch vereint 24 (halb-)fiktive Monologe junger türkisch- oder arabischstämmiger Männer, die sich in der deutschen Mehrheitsgesellschaft weder zugehörig noch akzeptiert fühlen. Das „Kanakisch“, in dem ihre Monologe gehalten sind, ist teilweise drastisch in der Ausdrucksweise und zweifellos vom Straßenjargon inspiriert, gleichzeitig aber eine hochstilisierte Kunstsprache. Ihr Erfinder trat damals zwar noch gern als quasikanakesker Bürgerschreck auf, wies sich aber schon mit diesem seinem Erstling als einer der virtuosesten Sprachartisten unter den deutschen Schriftstellern aus.
Feridun Zaimoğlu: „Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft“. Rotbuch, Berlin 1995, 144 Seiten, 12 Euro
Zadie Smith: „Zähne zeigen“

Familiensaga mit großen Schmökerqualitäten aus einer Stadt, wo Multikulti schon Realität war, als man in Deutschland noch nicht einmal ein Wort dafür hatte: London. Zadie Smith, Tochter einer Jamaikanerin und eines Engländers, verarbeitet in ihrem ersten Roman auch Teile der eigenen Familiengeschichte. Archie Jones und Samad Iqbal, ein Engländer und ein Bengale, sind beste Freunde seit ihrer gemeinsamen Zeit als Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Mitte der 70er-Jahre ziehen beide mit ihren Frauen in den Londoner Nordwesten und gründen dort ihre Familien. Die heranwachsenden Kinder haben ihre je eigenen Probleme, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, und stoßen auch bei den Eltern keineswegs immer auf Verständnis. Es ist im Grunde eine alte, sich immer wiederholende Geschichte, aber nicht nur durch das wirbelige multikulturelle Setting bekommt sie hier ein ganz neues, funkelndes Flair, sondern auch durch das überragende Erzähltalent der damals noch blutjungen Zadie Smith, die erst 24 war, als der Roman im Jahr 2000 erschien.
Zadie Smith: „Zähne zeigen“. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011, 656 Seiten, 12,99 Euro