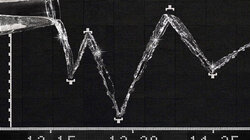Ohrringe, Hängematten, Haushaltsgegenstände: Pasquals Boutique könnte als ein typischer Gemischtwarenladen durchgehen – wären da nicht Verpackungen, die Tanzbewegungen und „sexy Sonnenbrände“ versprechen. Was im Laden um die Ecke für Stirnrunzeln sorgen würde, ist für Pasquals Kunden ganz normal. Der französische Händler betreibt sein Geschäft in „Second Life“: einer virtuellen 3-D-Welt mit fast vier Millionen registrierten Accounts.
Second Life gleicht auf den ersten Blick einem typischen Onlinespiel. Doch statt Monster zu schlachten, verdingen sich zahllose Nutzer wie Pasqual als Kleinstunternehmer. Designer verkaufen virtuelle Kleidung und Frisuren. Programmierer entwickeln kostenpflichtige Gesten und Bewegungen. Bars schenken virtuelle Getränke aus. Linden Lab, die Betreiberfirma von Second Life, geht davon aus, dass auf diese Weise derzeit monatlich rund zehn Millionen reale Dollar umgesetzt werden. „Second Life besitzt eine robuste Ökonomie“, erklärt Linden-Lab-Sprecherin Catherine Smith. Und Second Life ist kein Einzelfall. Auch in vielen anderen Onlinespielen sind in den letzten Jahren virtuelle Märkte entstanden, mit denen real Geld verdient wird. So ermittelten US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, dass das Multiplayer-Spiel „Everquest“ 2004 ein höheres Bruttosozialprodukt besaß als Namibia. Insgesamt werden weltweit pro Jahr bis zu 675 Millionen Euro in virtuellen Spielewelten erwirtschaftet.
Genaue Zahlen kennt allerdings niemand, da sich viele dieser Transaktionen in Grauzonen abspielen. So ist es Nutzern von „World of Warcraft“ verboten, sich mit Geld Vorteile zu erkaufen. Wer die im Spiel verwendete Goldwährung in die Hände bekommen will, muss sich in Kämpfen und mit Heldentaten bewähren. Alles andere gilt als Schummeln. Doch auf Webseiten von Drittanbietern gibt es nicht nur World-of-Warcraft-Gold, sondern auch ganze Spielerprofile mit zahlreichen fortgeschrittenen Fähigkeiten zu kaufen. Wer auf derartigen Schwarzmärkten Währungen oder Ausrüstungsgegenstände ersteht, trifft sich nach Geschäftsabschluss mit dem Händler zur Übergabe im Spiel. Second-Life-Betreiber Linden Lab bietet dagegen eine ganz offizielle Umtauschmöglichkeit für die eigene Währung an. Die Firma übernimmt dabei die Funktion einer Art Online-Wechselstube, die auf den An- und Verkauf der Second-Life-Währung spezialisiert ist. Wer sich das in der virtuellen Welt verdiente Geld auszahlen lassen will, bekommt von der Firma je nach Wechselkurs für rund 270 Linden-Dollar einen US-Dollar. Im Gegensatz zu den meisten anderen Betreibern besteht Linden Lab auch nicht darauf, der Alleinbesitzer der virtuellen Welt zu sein. „Ende 2003 krempelten wir die Ökonomie völlig um“, erklärt Catherine Smith dazu. „Wir gaben unseren Nutzern Eigentums- und Urheberrechte. Das war für den Markt ein Durchbruch.“
Sony wählte für sein Spiel „Everquest 2“ einen Mittelweg. Die Firma startete Mitte 2005 eine eigene Auktionsplattform, die auf zwei Server des Spiels begrenzt ist. Spieler können damit selbst entscheiden, ob sie in einer Abenteuerwelt mit oder ohne Kreditkarten-Magie antreten wollen. Sony nutzte die eigene Handelsplattform zudem für eine Studie, um mehr über die spielerischen Handelsbeziehungen zu erfahren. Dabei stellte die Firma fest, dass der Durchschnittsspieler pro Jahr rund 110 Euro für virtuelle Gegenwerte ausgibt. Begehrte Spielfiguren brachten ihren Verkäufern auch schon bis zu 1500 Euro ein. Die Nutzung eines solchen virtuellen Marktes ist offenbar je nach Alter unterschiedlich. Die meisten Verkäufer sind Anfang zwanzig, Käufer im Durchschnitt Mitte dreißig. Anders gesagt: Studenten mit viel Freizeit erarbeiten sich online Dinge, die sie an berufstätige und etwas ältere Spieler weiterverkaufen.
Sonys Handelsplattform ist auf US-Nutzer beschränkt. Der graue Markt der inoffiziellen Spielauktionen folgt jedoch den gleichen Ge-setzen der Globalisierung, die auch diesseits des Bildschirms gelten. Wenn Spieler in Europa oder den USA Gold für ihre World-of-Warcraft-Figur kaufen, dann stammt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Ländern wie China, Vietnam oder den Philippinen. Immer mehr Unternehmer verlagern die arbeitsintensiven Aspekte der Spielökonomie in derartige Niedriglohnländer. So gibt es Berichte von virtuellen Sweatshops in China, in denen Angestellte zehn Stunden am Tag für gerade mal 43 Eurocent pro Stunde Onlinegold schürfen. In den letzten Monaten haben immer mehr große Konzerne virtuelle Welten für sich entdeckt. So werben Mercedes-Benz, IBM und Dell in Second Life für ihre Produkte. Der Axel-Springer-Konzern hat sogar mit dem Vertrieb einer digitalen Second-Life-Klatschzeitschrift begonnen. Ausbeutung wird von den Betreibern derartiger Spiele angesichts dieses Booms nur ungern thematisiert. Doch Niedriglöhne sind nicht die einzige Schattenseite virtueller Ökonomien. Linden Lab unterhält mittlerweile 4000 Server, um dem Ansturm der Nutzer standzuhalten. Ein US-Wirtschaftsexperte ermittelte im Dezember, dass der durchschnittliche Second-Life-Charakter damit nahezu genauso viel Strom verbraucht wie ein lebendiger Bewohner Brasiliens.
Schließlich gilt in virtuellen Märkten wie in der realen Welt: Reich werden damit nur die wenigsten. Zwar verkündete die Frankfurter Online-Unternehmerin Ailin Gräf im November, mehr als eine Million Dollar mit Landspekulationen in Second Life eingenommen zu haben. Doch von den knapp vier Millionen Second-Life-Bewohnern verdienen nur rund 100 mehr als 5000 US-Dollar pro Monat. Viele Nutzer haben dagegen mit denselben Problemen zu kämpfen wie Pasqual, dessen Boutique meistens gähnend leer ist. „Das Geschäft läuft schlecht“, berichtet der Franzose leicht resigniert. „Aber von irgendwas muss man hier ja leben.“