Ein Mittwoch im Juli 2017. Zwei (reale) Nachrichten, die scheinbar nichts mit einander zu tun haben, laufen über den „Ticker“, jenes Portal, über das Medien Nachrichten von den Agenturen beziehen: „Eine Frau aus Kamerun hat während eines Rettungseinsatzes im Mittelmeer ein Baby zur Welt gebracht“, meldet die Deutsche Presseagentur. „Mutter und Kind seien noch durch die Nabelschnur verbunden gewesen, als sie von einem Holzboot an Bord des Rettungsschiffes gebracht wurden.“
Und: „Einer der größten jemals gesichteten Eisberge hat sich von der Antarktis gelöst“, meldet Agence France Press eine Stunde und 20 Minuten später. „Die Ablösung der Eismassen könnte das Eisschelf destabilisieren, wodurch ein deutlicher Anstieg des weltweiten Meeresspiegels drohen könnte.“
Reale Ereignisse, die zeitlich parallel ablaufen. In den Köpfen gehören sie nicht unbedingt zusammen. Noch nicht. Megan Hunters Debütroman „Vom Ende an“ – eine „Ecofiction“ – denkt voraus. Dort sind die beiden Ereignisse aufs Engste miteinander verknüpft.
Die Fruchtblase platzt, das Wasser steigt
Die junge Mutter, aus deren Perspektive Hunter in flüchtigen Bildern und in so poetischen wie fragmentarischen Absätzen erzählt, stammt nicht aus Kamerun. Sie ist Engländerin. Und es ist Großbritannien, das überflutet wird und damit nicht nur im Wasser, sondern auch im Ausnahmezustand versinkt. Es gibt kein „könnte“ mehr, wenn vom steigenden Meeresspiegel die Rede ist, nur noch unmittelbare Realität: unbewohnbare Häuser, die schnellstmöglich zu verlassen sind, Nahrungsmittelknappheit, Verteilungskämpfe, Auffanglager, Verrohung, Misstrauen, Ungewissheit, zähes Ausharren, Flucht und Tod. Die Katastrophe ist da, obwohl sie nie direkt beschrieben wird.
vom ende an
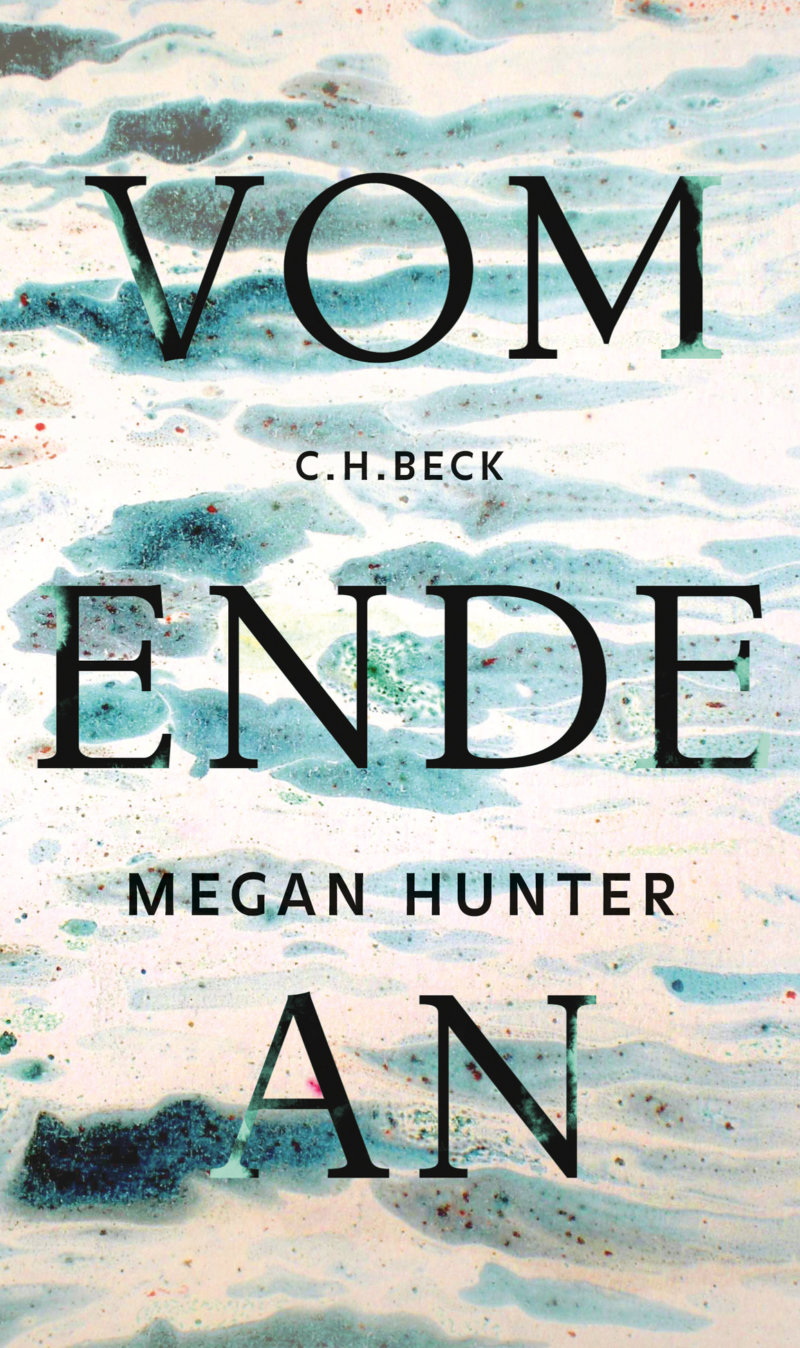
Megan Hunter: „Vom Ende an“. Aus dem Englischen von Karen Nölle. C.H. Beck, München 2017, 160 Seiten, 16 Euro
Was Hunter gelingt, ist ein zur Stunde bitter nötiger Roman. Zum einen, weil die Autorin mit ihrer Dystopie deutlich macht, dass Flucht auch Europa betrifft und Europäerinnen und Europäer Solidarität mit Geflüchteten oft vermissen lassen. Zum anderen, weil sie zu denken wagt, was viele Menschen gerne in eine unbestimmte Zukunft schieben: dass Europa die Auswirkungen „des Klimawandels“ drastisch zu spüren bekommen wird, ein Szenario, das laut einer besorgniserregenden und deshalb viel beachteten Recherche im „New York Magazine“ nicht unwahrscheinlich ist.
Das aber ist nur eine Ebene dieses vielschichtigen Erstlingswerks. Die Wahrheit, die unter alldem liegt, ist die der absurden und zugleich ungemein organischen Parallelität: Ein Kind wird geboren, während die Welt untergeht.
Geburt und Apokalypse. Ende und Neubeginn. Näher am Leben geht eigentlich nicht. Eine Verbindung, die häufig aus dem Alltag verbannt wird.
Ein Kind wird geboren, die Welt geht unter
Was so sichtbar wird, ist der universelle und deshalb durchaus philosophische Kreislauf, der durch Leben und Sterben entsteht. „Z“ tauft die Protagonistin ihr Kind – mehr als Anfangsbuchstaben gesteht die Autorin ihren Figuren nicht zu. Der letzte Buchstabe im Alphabet, das Ende ist der Neubeginn. Und so beschreibt auch die Geschichte, die die junge britische Lyrikerin mehr in kurzen Szenen, Bildern und Gedanken als in einer durchgängigen Handlung erzählt, einen Kreis.
Nichts bleibt. Alles ist beweglich, in Veränderung. Und auch die schlimmste Katastrophe wird eines Tages vorübergehen, lautet die versöhnliche Botschaft. Nur wer am Alten festhalten und die Veränderung nicht akzeptieren will, leidet unter dem, was geschieht. Wer sich der Veränderung hingibt, bei sich bleibt, nur auf das Unmittelbarste blickt – ein Kind zum Beispiel, dessen zarter Flaum hinterm Ohr so unwiderstehlich riecht –, wird auch das Schlimmste überstehen.
Titelbild: Tomasso Protti/NYT/Redux/laif







