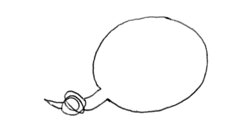„Du siehst nicht aus wie eine Türkin.“ Wie sehen Türken denn aus? Meistens erhalte ich keine Antwort auf diese Frage. Wenn ich wüsste, welches Türkenbild genau gemeint ist, würde ich mich sogar etwas bemühen, es zu erfüllen.
Als ich zwölf war, wohnten wir im sechsten Stock eines wirklich grauen und wirklich sehr hässlichen Hochhauses in Berlin. Es klingelte, vor der Tür standen die Jungs von den Pfadfindern und wollten „den Ebru“ sprechen und in die Gruppe einladen. Feuer machen, Liederchen singen, zelten. Als meine Mutter mich süffisant aus meinem Zimmer rief, wollte ich nur noch ganz schnell Hanna heißen und meine Eltern mit ihrem ungelenken, harten Deutsch auf der Stelle umtauschen. Das mit dem Umtauschen hatte ich dann noch oft. Ich schämte mich für meine Eltern, vor allem an den Elternsprechtagen, wenn alle Väter im Anzug kamen und selbstsicher mit den Lehrern plauderten, während meinem Vater in seinem gestreiften C & A-Hemd und Motoröl unter den Fingernägeln kaum die richtigen Fragen einfielen. Meine Eltern freuten sich nur, dass die Lehrer wenig klagten, obwohl ich nicht zu den Allerbesten in der Klasse gehörte. Für mich hatte Türkischsein in dieser Zeit viel mit Schämen zu tun. Alles, was an uns anders war, war eben ein Manko, war ein Nichtdeutschsein. So einfach. So unklug. Meine Lehrerin an der Oberschule, die uns einmal zu Hause besuchte, beschwerte sich am nächsten Tag bei mir, dass es bei uns im Wohnzimmer so wenig türkisch aussah. Aber so sieht es doch in allen türkischen Wohnungen aus, dachte ich: graubeige Wohnzimmergarnitur, Schrankwand, Esstisch zum Ausziehen. Immer picobello aufgeräumt. Meine Mutter ließ trotz ihrer zwei Jobs alle deutschen Nachbarn und Eltern aus der Klasse nicht unter einem mehrgängigen Essen nach Hause. „Ihr Türken seid ja so gastfreundlich“, schallte es aus dem Wohnzimmer meiner Eltern, und ich weiß gar nicht, ob mich eher das gastfreundliche müde Nicken meiner Eltern ankotzte oder die Tatsache, dass die Nachbarin meiner Mutter nun schon zum dritten Mal zum Essen kam, während sie ihre eigene Einladung zur Kaffeerunde immer wieder verschob.
Mittlerweile leben meine Eltern wieder in der Türkei und sind in ihrem Ort die Vorzeigedeutschen. Meine Mutter backt den besten altdeutschen Apfelkuchen, und mein Vater brüllt jeden Handwerker an, der nicht um neun Uhr wie angekündigt auf der Matte steht. Er hält ihnen Vorträge über Deutschland, darüber, wie sauber und ordentlich hier alles ist, weil sich die Deutschen aufeinander verlassen können. Identität scheint mir die Abwesenheit einer bestimmten Grundmasse um einen herum zu sein, und mein Deutschsein lässt sich auch immer daran messen, wie sehr mich das Umfeld auf meine türkische Seite reduziert.
Für die Soziologen gehöre ich seit den 1980er-Jahren zu einer verlorenen Generation, deren Vertreter stets zwischen zwei Stühlen saßen und die in den 1990er-Jahren von ihrem Erdkundelehrer gefragt wurden, was „ihr Türken“ denn mit „den Kurden anstellt“. Ich heiratete früh, konnte aber in den Augen meiner frauenbewegten deutschen Kolleginnen nur das Anhängsel eines türkischen Machos sein. Und als Journalistin erhielt ich stets Aufträge zur Türkei und zum Islam. Mein Expertentum scheint sich an meinem Namen zu manifestieren und nicht daran, was ich kann und gelernt habe.
Wäre ich nicht die „Türkin“, würden sich einige Erfahrungen nicht machen lassen. Da würde der Pfleger im Krankenhaus fehlen, der sich besonders weltoffen gibt und sich mit einem lautstarken „Merhaaaaabaaaa“ an mich wendet. Da würde auch die nette Kellnerin im teuersten Café in Stralsund fehlen, die mir anerkennend ein „Das sieht man Ihnen aber gar nicht an“ bescheinigt, nachdem sie gefragt hat, was meine Tochter denn für eine niedliche Sprache spreche. Und fehlen würden mir die kleinen und großen Sticheleien, in denen es immer wieder darum geht, dass mein Gegenüber denkt, mein Leben drehe sich um einen Dönerspieß und dass ich schon morgens nach dem Aufstehen über meine nationale Identität nachdenke. Ehrlich: Sie ist zusammengenäht wie eine Patchworkdecke oder verschachtelt wie eine Matroschka-Puppe. Meine beiden Großväter kamen aus Bulgarien, meine Großmutter aus Tscherkessien, meine andere Großmutter aus Griechenland. In dem, was meine Eltern aus ihrem Elternhaus kochen, entdecke ich die jüdische, armenische und slawische Küche. All das gehört für mich zum Türkischsein, es ist nichts Abgeschlossenes und Festes, genauso wenig wie mein „Deutschsein“. Die deutsche Identität hat für mich immer ein „Aber“, denn das Deutsche in mir hat sich ja nicht durch die Deutschen um mich herum ausgebildet, sondern oft trotz der Deutschen um mich herum. Hört sich doof an, ist aber so: Vallah, ich liebe Deutschland. Zum Beispiel das von Kurt Tucholsky und Erich Kästner. Und ich liebe die Türkei der Volkssänger, der Sufi-Dichter und der bodenständigen, patenten Frauen.
Und dann werde ich doch wieder gefragt, wie türkisch ich mich noch fühle, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie einfach. Wie unklug.